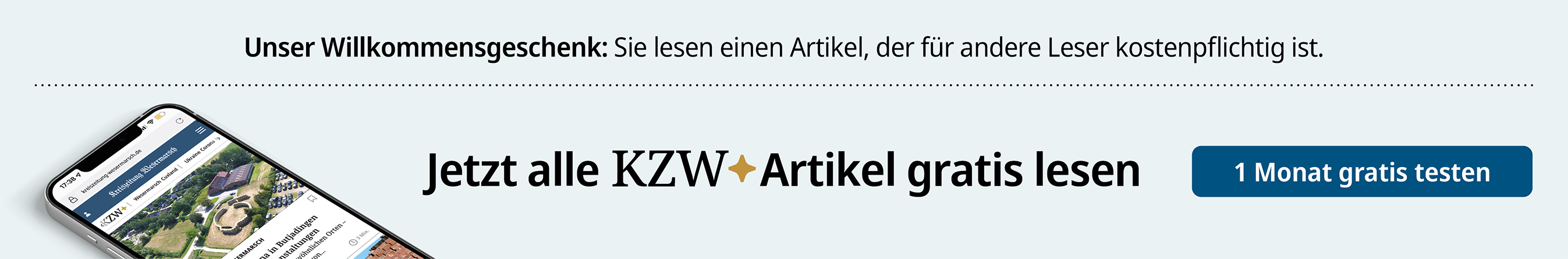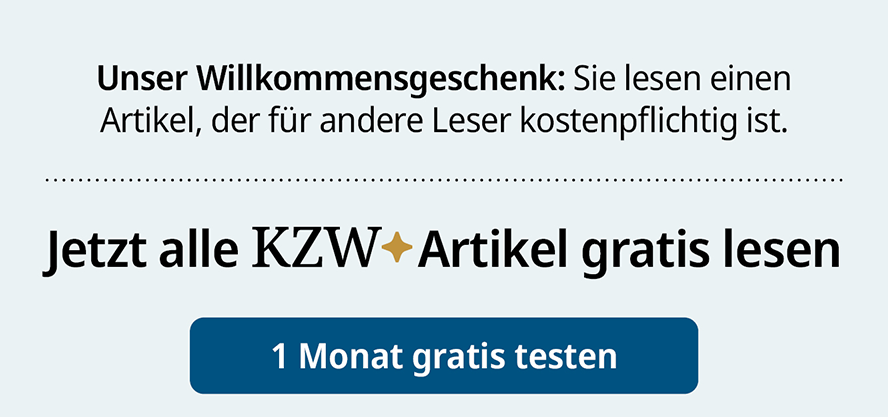Ihr Algenlabor steckt im blauen Container. Noch. Dort wächst Spirulina so gut, dass sie bald in einen 1.000-Liter-Wassertank umziehen darf. Die nächstgrößere Test-Stufe wäre dann ein Bioreaktor mit mindestens zehn Kubikmetern Fassungsvermögen und modernster Lichttechnik, den das Team um Projektleiter Dr. Stephan Ende in Nordenham im Technologiezentrum aufbauen darf. Die Aquakulturforscher vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven arbeiten an einer biologischen Entsalzungsanlage, die auf Mikroalgen basiert. Die Metropolregion Nordwest unterstützt das Projekt mit 68.000 Euro. „Das ist natürlich eine super Starthilfe“, freut sich der Projektleiter.

Kleine Kringel als Helfer: Mit der Mikroalge Spirulina, die (von links) Cynthia Couto, Stephan Ende und Albert Beyer auf dem Handyfoto zeigen, wollen AWI-Forscher Wasser entsalzen. Die Wirtschaftsförderung Wesermarsch, hier vertreten durch Tobias Busch (rechts), hofft auch auf einen Beitrag für die Wasserstofftechnologie. Foto: Scheschonka
Tests mit verschiedenen Abfällen
Albert Beyer, Student der Uni Freiburg, zeigt Kolben mit verschiedenen Ansätzen für die Einzeller. Mal hat sich eine satt-grüne Flüssigkeit gebildet, mal ist sie fast durchsichtig und wird erst beim Aufschütteln hellgrün. „Es ist deutlich zu sehen, dass die Mikroalge unterschiedlich gut wächst.“ Auf der anderen Seite hängen längliche Plastikschläuche - sogenannte Algenbags mit bis zu 15 Litern Fassungsvermögen. Auch darin wachsen die Einzeller gut.

Mit den Mikroalgen, die der Student Albert Meyer hier in sogenannten Algen-Bags zeigt, wollen AWI-Forscher Wasser entsalzen. Foto: Scheschonka
Beyer hat seine Abschlussarbeit darüber geschrieben, welche lokalen Abfallströme sich noch nutzen lassen. „Wir testen verschiedene Einsatzmöglichkeiten“, erläutert Ende. Spirulina ist in manchen Industriezweigen nachgefragt, zum Beispiel in der Lebensmittelbranche. Abgesehen vom blauen Farbstoff kann sie wichtige Nährstoffe und Spurenelemente liefern. Zum Jahresende kommt ein Buch von Ende über solche Algen-Anwendungen heraus (Titel: „Value-added Products from Algae: Phycochemical Production and Applications“).
Verwertbare Algenmasse
Für die Entsalzungstests haben die Projektmitarbeiter Salzsole von Helgoland geholt. Die Insel nutzt Meerwasser für die Trinkwassergewinnung. Doch die technische Entsalzung hat Nachteile. „Wir wollen ein biologisches Verfahren anbieten“, sagt Ende. Dann bleibt am Ende keine Salzlake übrig, sondern eine Algen-Masse, mit der sich etwas anfangen lässt. Sie bietet sich mit ihrem Proteingehalt beispielsweise als Futtermittel in der Tierhaltung an. Spirulina haben die Bremerhavener Wissenschaftler auch deshalb ausgesucht, weil diese Mikroalge schon einen „Grasstatus“ besitzt, was wiederum die Zulassung als Futtermittel leichter macht.
Neue Bedarfe für entsalztes Wasser
Das Entsalzungsthema wird wahrscheinlich wegen der Wasserstofftechnologie noch größer. Die Elektrolyseure, die Wasserstoff produzieren, brauchen Wasser als Ausgangsstoff. Man wird am Ende aufs Meerwasser zurückgreifen (müssen). Doch die Elektrolyseure sind empfindlich. Das Meerwasser muss vorher entsalzt werden. Salzsolen entstehen aber auch in verschiedenen industriellen Prozessen. Kein Wunder, dass entsprechende Unternehmen das Projekt unterstützen.